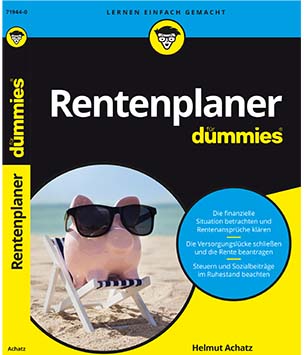Werbung
Leben Reiche wirklich länger? Die Statistik lässt diesen Schluss zu. Aber von der Rente auf die Lebenserwartung zu schließen, ist zu einfach.
Zusammenhang zwischen Wohlstand und Lebensdauer?
Der Bericht der Bundesregierung als Antwort auf die Kleine Anfrage der AfD-Fraktion zur „Entwicklung der Rentenbezugsdauer von Altersrenten“ beleuchtete eine der zentralen Fragen der sozialen Ungleichheit in Deutschland: Gibt es einen Zusammenhang zwischen Wohlstand und Lebensdauer? Die Regierung betonte in ihrer Antwort die Schwierigkeit, eine direkte Kausalität nachzuweisen, und verwies auf die Komplexität der Zusammenhänge sowie die statistischen Grenzen der vorliegenden Rentendaten. Verständlich, da die offizielle Rentenstatistik nicht alle sozioökonomischen Umstände erfasst.
Die unbestreitbare Kluft
Ja, statistisch leben Reiche länger als Arme – die Differenz in der Lebensdauer ist messbar. Eine Studie des Robert Koch-Instituts (RKI) zeigt, dass reiche Männer in Deutschland durchschnittlich 8,6 Jahre länger leben als arme, während die Differenz bei Frauen 4,4 Jahre beträgt. Das Ifo Institut bestätigt eine ähnliche Größenordnung und stellt fest, dass die reichsten zehn Prozent der Bevölkerung im Durchschnitt sieben Jahre länger leben als die ärmsten zehn Prozent. Darüber hinaus gibt es regionale Unterschiede.
Lebenserwartung nach Bundesländern
| Lebenserwartung nach Bundesländern (Stand 2025) | ||||
|---|---|---|---|---|
| Bundesland | Lebenserwartung 👩💼 | Lebenserwartung 👨🦰 | Position 👩🦰 | Position 🧔♂️ |
| Baden-Württemberg | 84,13 | 79,92 | 1 | 1 |
| Bayern | 83,74 | 79,34 | 3 | 2 |
| Berlin | 83,29 | 78,37 | 5 | 6 |
| Brandenburg | 83,42 | 77,66 | 4 | 11 |
| Bremen | 82,06 | 76,74 | 15 | 14 |
| Hamburg | 83,10 | 78,41 | 8 | 5 |
| Hessen | 83,28 | 78,88 | 6 | 3 |
| Mecklenburg-Vorpommern | 82,78 | 76,53 | 10 | 15 |
| Niedersachsen | 82,63 | 77,96 | 12 | 10 |
| Nordrhein-Westfalen | 82,58 | 78,13 | 13 | 8 |
| Rheinland-Pfalz | 83,03 | 78,60 | 9 | 4 |
| Saarland | 81,97 | 77,38 | 16 | 12 |
| Sachsen | 84,02 | 78,04 | 2 | 9 |
| Sachsen-Anhalt | 82,27 | 75,93 | 14 | 16 |
| Schleswig-Holstein | 82,76 | 78,34 | 11 | 7 |
| Thüringen | 83,14 | 77,38 | 7 | 13 |
| Bundesweit | 83,2 | 78,5 | ||
Diese Ungleichheit hat sich sogar in den vergangenen Jahren noch verstärkt. Seit den frühen 2000er-Jahren hat sich die Lebenserwartungslücke noch vergrößert. Die Corona-Pandemie hat diese Entwicklung noch beschleunigt. Einkommensschwache Gruppen sind besonders anfällig für Krisen, da sie häufig in Berufen mit physischer Präsenz arbeiten und in beengten Wohnverhältnissen leben, was das Infektionsrisiko erhöht. Die Pandemie fungierte somit als ein Katalysator für eine bereits bestehende Ungleichheit.
Studien über die Lebensdauer-Lücke
| Quelle | Jahr | Sozialindikator | Lücke bei Männern (Jahre) | Lücke bei Frauen (Jahre) |
| RKI | 2020-2022 | Deprivierte vs. wohlhabende Regionen | 7,2 | 4,3 |
| RKI | 2003-2005 | Deprivierte vs. wohlhabende Regionen | 5,7 | 2,6 |
| RKI | Aktuell | Einkommensgruppen (höchste vs. niedrigste) | 8,6 | 4,4 |
| Ifo | Aktuell | Reichste vs. ärmste 10 % | 7,0 | Nicht spezifiziert |
| DIW | 2012 | Höchste vs. niedrigste Einkommensgruppe (ab 65 J.) | 5,0 | 3,5 |
| Demografische Forschung | 2016 | Niedrigstes vs. höchstes Einkommensquartil (ab 40 J.) | 5,5 | 4,0 |
Die Ursachen der Ungleichheit
Die Ursachen für die Ungleichheit in der Lebenserwartung: Das ist ein Geflecht aus Bildung, Einkommen, Arbeitsbedingungen und Gesundheitsverhalten. An der Basis dieses Gefüges steht die Bildung als zentraler Hebel für die Lebenserwartung, wie es der renommierte TV-Arzt Eckart von Hirschhausen treffend formulierte. Ein höherer Bildungsabschluss wirkt sich auf vielfältige Weise positiv auf die Gesundheit und Lebenserwartung aus. Er öffnet die Tür zu Berufen mit höherem Einkommen, weniger körperlicher Belastung und psychischem Stress sowie mehr Autonomie und Gestaltungsspielraum. Darüber hinaus vermittelt Bildung eine höhere „Health Literacy“ – die Fähigkeit, gesundheitsrelevante Informationen zu verstehen und umzusetzen. Studien zeigen, dass sich Menschen mit höherer Bildung tendenziell gesundheitsbewusster verhalten, wie etwa weniger Rauchen, bessere Ernährung und mehr körperliche Bewegung.
Diese Faktoren schaffen einen sich selbst verstärkenden Kreislauf aus Vorteil und Nachteil. Ein höheres Bildungsniveau führt zu besseren Arbeits- und Lebensbedingungen, die Stress reduzieren und einen gesunden Lebensstil fördern. Dies wiederum wirkt sich positiv auf die körperliche und geistige Gesundheit aus, was die Arbeitsfähigkeit und das Potenzial für weiteres Einkommen sichert und somit zu einer längeren Lebensdauer beiträgt. Umgekehrt sind Menschen mit geringerer Bildung häufiger in körperlich anspruchsvollen oder prekären Berufen anzutreffen, die höhere Gesundheitsrisiken bergen und zudem von schlechteren Lebensbedingungen begleitet sind. Gesundheitliche Einschränkungen, die dadurch entstehen, können wiederum den beruflichen Aufstieg erschweren oder verhindern, wodurch sich die negativen Effekte akkumulieren.
Der direkte Zusammenhang zwischen Einkommen und Sterblichkeitsrisiko ist ebenfalls unbestreitbar. Das lässt sich auch anhand von Berufen illustrieren: Eine Studie des Bundesinstituts für Bevölkerungsforschung (BiB) zeigt, dass die durchschnittliche Lebenserwartung von Landwirten und einfachen Arbeitern deutlich unter der von Angestellten oder Beamten liegt.
Es gibt aber Unterschiede zwischen Mann und Frau: Während bei Männern das individuelle Einkommen stark mit dem Sterberisiko zusammenhängt, zeigt sich dieser Effekt bei Frauen nicht eindeutig. Für Frauen ist das Haushaltseinkommen entscheidend. Frauen kümmern sich, unabhängig von ihrem Bildungsstand, häufig um Kinder oder pflegebedürftige Angehörige. Ihr persönliches Einkommen ist daher kein verlässliches Maß für ihren tatsächlichen Lebensstandard oder den Zugang zu Ressourcen wie gesunder Ernährung oder hochwertiger medizinischer Versorgung, die oft durch das Einkommen des Partners im Haushalt finanziert werden.
Äquivalenzprinzip des Rentensystems
Die ursprüngliche Anfrage an die Bundesregierung zielte auf die Rentenbezugsdauer ab – und die Frage zur Gerechtigkeit im deutschen Rentensystem: Die Daten der Deutschen Rentenversicherung belegen eine signifikante Diskrepanz in der Rentenbezugsdauer: Wer 3.000 Euro und mehr bekommt, bezieht seine Rente im Durchschnitt 28,9 Jahren, während ein Betrag von 2.500 bis 3.000 Euro im Schnitt nur 20,6 Jahre bezogen wird. Das heißt, Menschen mit höherem Einkommen beziehen ihre Rente länger.
Und damit kommen wir zu dem Widerspruch des Äquivalenzprinzips, das besagt, dass höhere Beiträge zu höheren Rentenansprüchen führen: Da jedoch Besserverdienende aufgrund ihrer längeren Lebensdauer nicht nur höhere, sondern auch längerfristige Rentenzahlungen erhalten, kommt es zu einer unbeabsichtigten, aber systemischen Umverteilung von Beiträgen „von unten nach oben“. Menschen mit geringerem Einkommen zahlen mehr in das System ein, gemessen an ihrer kürzeren Rentenbezugsdauer.
Problem dabei: Rückschlüsse aus der Rentenlaufzeit und Rentenhöhe auf den sozialen Status allein sind nicht zulässig, da die Rentenversicherung andere Einkommensquellen wie Mieten, betriebliche und private Altersvorsorge nicht berücksichtigt. An dieser ungleichen Lebenserwartung reiben sich aber immer wieder die Kritiker und sehen die Ungleichheit als ungerecht an.
Forderung nach Gerechtigkeit
Einige nehmen die Ungleichheit in der Lebenserwartung als ein größeres Problem wahr. Das Äquivalenzprinzip, nach dem jeder entsprechend seinen Einzahlungen auch Rente bekommt, zu verwässern, ist keine Lösung. Vor diesem Hintergrund erscheinen präventive Maßnahmen und gezielte Gesundheitsaufklärungskampagnen, die das Gesundheitsbewusstsein von Personen mit geringerer Bildung stärker berücksichtigen, unerlässlich.
Werbung